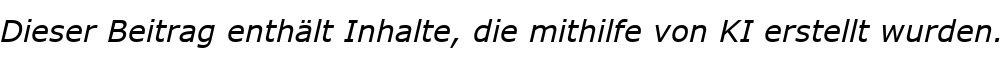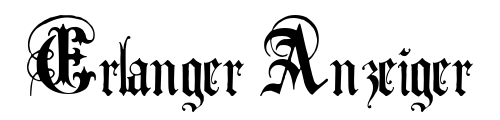Der Bänkelgesang hat seine Wurzeln im Mittelalter und entwickelte sich insbesondere im 17. Jahrhundert, als Bänkelsänger auf Jahrmärkten und Marktplätzen auftraten, um das Publikum mit ihren Versen zu fesseln. Diese Art des Erzählens erlebte im 19. Jahrhundert ihre Blütezeit, nicht zuletzt durch den Buchdruck, der es ermöglichte, die Geschichten und Lieder in Form von Flugblättern zu verbreiten. Nachrichtenkolporteure und die sogenannten cantastorie trugen zur Popularität dieser Tradition bei. In den 1930er Jahren und während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurden die Themen oft von der Zeitgeschichte beeinflusst, was die Bänkleinsänger zu sozialen Wahrzeichen ihrer Epoche machte. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Bänkelgesang von Ernst Becker. Mit Schild und Gesang waren sie Botschafter der damaligen Gesellschaft und spiegelten deren Hoffnungen und Ängste wider.
Bänkelsänger als soziale Wahrzeichen
Bänkelsänger waren im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert hinein unverzichtbare Botschafter der Nachrichten. Als Nachrichtenkolporteure trugen sie die Geschichten der Menschen in ihren Versen vor, oft in Form von Moritatensängern, die von Mord und Totschlag berichteten. Diese cantastorie standen besonders auf Märkten und Volksfesten, wo sie vor einem breiten Publikum auftraten. Ihre soziale Stellung war ambivalent. Während das fahrende Volk oft als unehrliche Leute galt, hatten die Bänkelsänger eine gewisse Akzeptanz, da sie nicht nur unterhielten, sondern auch Wissen und Nachrichten verbreiteten. Ein berühmtes Beispiel ist das Lied von den Fünf unglücklichen deutschen Matrosen, das noch heute die Geschichten des 17. und 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Im Kriminalmuseum von 1709 kann man mehr über die Rolle dieser Bänkleinsänger erfahren und ihren Einfluss auf die Gesellschaft der neuen Zeit nachvollziehen.
Die Rolle von Moritat und Flugblättern
Moritat und Liedflugblätter sind essentielle Bestandteile des Bänkelgesangs, die in die Tradition der volkstümlichen Dichtungen eintauchen. Diese Formen volkstümlicher Kunst, vor allem in der Newen Zeitungen verbreitet, wurden oft genutzt, um bürglich-historische Nachrichtenformen transportieren. Moritaten, als hochtragende Erzähl- und Grablieder, zogen das Publikum mit ihren dramatischen Geschichten in ihren Bann. Bänkelsänger wie Franz Barth und Michael von Jung verhalfen diesen Liedern zu Popularität und verknüpften sie mit den zeitgenössischen Anliegen des Barock, Klassizismus und der Frühromantik. Sie boten nicht nur Unterhaltung, sondern auch kritische Reflexionen über die Gesellschaft, wie Friedrich Theodor Vischer in seinen Schauerballaden anschaulich darstellt. Diese Drehorgellieder und Gassenhauer verwoben Poesie mit Noten, die den Menschen in den Straßen näherbrachten, was die Faszination des Bänkelgesangs verdeutlicht.
Ein Blick auf die Musikalität der Bänkellieder
Die Musikalität der Bänkellieder spiegelt die gesamteuropäische Erscheinung des Bänkelgesangs wider, der im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert hinein florierte. Bänkelsänger fungierten als Nachrichtenkolporteure und erzählten faszinierende Geschichten von Naturereignissen, Familientragödien und frevelhaften Handlungen. Durch die Verwendung verschiedener Instrumente wurden diese dramatischen Inhalte musikalisch untermalt und erhielten eine moralisch-didaktische Komponente, die zur Belehrung der Zuhörer beitrug. Diese Form der Unterhaltung hat auch moderne Parallelen in Genres wie Rock und Rap, die ähnliche Themen von Recht und Unrecht behandeln. In Städten wie Bayern und Rothenburg ob der Tauber, wo Symposium und Kriminalmuseum die Geschichte des Bänkelsangs beleuchten, wird die Aktualität und Tragik dieser Lieder weiterhin gewürdigt und bewahrt.
Auch interessant: